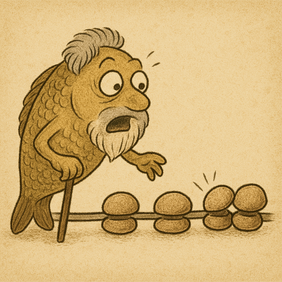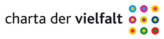Jena/Pisa/Stanford. AlsProteostase wird das Gleichgewicht der Proteine (Eiweiße) in der Zelle bezeichnet, zu dem die kontinuierliche Produktion neuer Proteine, deren korrekte Faltung sowie der Abbau beschädigter oder überflüssiger Proteine gehört. Dieses Gleichgewicht ist essenziell für die Zellgesundheit; gerät es aus dem Lot, können sich fehlgefaltete oder überflüssige Proteine ansammeln – mit potenziell schädlichen Folgen. Solche Störungen sind ein typisches Merkmal des Alterns und stehen in engem Zusammenhang mit Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson.
Wie der Alternsprozess die Proteostase im Gehirn beeinflusst, hat nun ein internationales Forschungsteam des Leibniz-Instituts für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) in Jena, der Scuola Normale Superiore in Pisa und der Stanford University untersucht. Dabei wurde ein zentraler Mechanismus identifiziert, der im alternden Gehirn die Proteostase stört – mit weitreichenden Konsequenzen. Die Ergebnisse wurde jetzt in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.
Modellorganismus Killifisch liefert präzise Einblicke
Untersucht wurde das Gehirn des kurzlebigen Killifischs (Nothobranchius furzeri), einem etablierten Modellorganismus in der Alternsforschung, der typische altersbedingte Veränderungen des Gehirns wie z. B. neurodegenerative Prozesse zeigt.
Das Team analysierte dabei umfassend, wie während des Alterns die Genexpression reguliert wird – vom Ablesen der Erbinformation (Transkriptom), über die Proteinherstellung durch Ribosomen (Translatom), bis hin zur tatsächlichen Zusammensetzung der gebildeten Proteine (Proteom).
„Durch diesen mehrstufigen Ansatz konnten wir sehr präzise bestimmen, auf welcher Ebene alternsbedingte Veränderungen auftreten und welche Mechanismen dabei gestört sind“, erklärt Domenico Di Fraia, ehemaliger Doktorand des FLI und Co-Erstautor der Studie.
Protein-Verlust trotz intaktem Bauplan
Im Zentrum der Studie stand eine auffällige Beobachtung: Viele Proteine, insbesondere solche mit zahlreichen basischen Aminosäuren (z.B. Arginin, Lysin), nahmen im alternden Gehirn deutlich ab. Diese Proteine spielen eine zentrale Rolle bei der DNA- und RNA-Verarbeitung sowie bei der Bildung von Ribosomen. Ihr Fehlen kann weitreichende zelluläre Folgen haben.
Überraschend war: Die mRNA, also der dazugehörige Bauplan dieser Proteine, war in normalen Mengen vorhanden. „Das war für uns ein klares Zeichen, dass hier kein Problem beim Abbau, sondern bei der Herstellung der Proteine vorliegen muss“, erklärt Dr. Alessandro Ori, assoziierter Forschungsgruppenleiter am FLI.
Weitere Analysen zeigten, dass die Ribosomen - die „Proteinfabriken“ der Zelle, die Proteine anhand von mRNA-Bauplänen herstellen – an Sequenzen mit basischen Aminosäuren hängen blieben. Die Ribosomen „pausierten“ oder kollidierten sogar, sodass das entsprechende Protein nicht korrekt fertiggestellt werden konnte oder gar nicht erst entstand. Ein Hinweis auf eine spezifische Störung der Translation im alternden Gehirn.
Diese Störungen betrafen vor allem Proteine, die für wichtige zentrale Aufgaben zuständig sind, wie die DNA-Reparatur, die RNA-Verarbeitung, die Zellteilung und die Energieproduktion in den Mitochondrien. Sie sind somit eng mit vielen bereits bekannten „Hallmarks of Aging“ verbunden – typischen biologischen Merkmalen des Alterns.
Translation gestört – nicht der Proteinabbau
Um auszuschließen, dass der Proteinverlust nicht auf einem verstärkten Abbau basiert, blockierte das Team gezielt das Proteasom – das zelluläre „Abfallentsorgungssystem“. Dieses stellt die Qualität der Proteine sicher, indem es gezielt beschädigte, falsch gefaltete oder nicht mehr benötigte Proteine abbaut und damit hilft, die Funktion und Stabilität der Zellprozesse aufrechtzuerhalten.
„Zwar veränderte sich das Proteom dadurch insgesamt, doch der Verlust der basischen Proteine blieb weiter bestehen. Sie wurden also nicht abgebaut, sondern offenbar gar nicht erst korrekt hergestellt. Dies bestätigte unsere Annahme, dass die Ursache auf der Ebene der Translation liegt – also bei der Proteinbiosynthese“, so Antonio Marino, ehemaliger Doktorand am FLI und ebenfalls Co-Erstautor der Studie.
Kettenreaktion im alternden Gehirn
Mit Hilfe eines integrativen Modells konnte außerdem gezeigt werden, dass die verringerte Ribosomenfunktion im Alter die Herstellung bestimmter Proteine stärker beeinträchtigt als die anderer Proteine. Einige mRNAs werden sogar effizienter ausgelesen, da es weniger „Staus“ gibt, andere dagegen kaum noch. Dies führt zu einer Art Kettenreaktion: Fehlende Ribosomen bewirken weitere Änderungen bei der Translation und tragen so zusätzlich zu einer Veränderung der Proteinzusammensetzung alter Gehirne bei.
„Davon besonders betroffen sind Proteine der Mitochondrien und des Nervensystems,“ ergänzt Alessandro Ori. „Diese Verschiebung bringt das Gleichgewicht der Proteine im Gehirn durcheinander – und könnte ein möglicher Auslöser für alternsbedingte Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson sein.“
Wegweisende Erkenntnis für Alterns- und Demenzforschung
Die Studie liefert erstmals eine schlüssige Erklärung dafür, warum im alternden Gehirn mRNA- und Proteinspiegel oft nicht mehr übereinstimmen – ein Phänomen, das auch beim Menschen bekannt ist. Der Grund ist eine Fehlfunktion bei der Proteinsynthese, bei der Ribosomen ins Stocken geraten. „Wir haben eine Schwachstelle in der zellulären Maschinerie identifiziert, die mit dem Alter zunehmend versagt“, erklärt Dr. Ori. „Diese Fehlfunktion könnte eine zentrale Rolle bei der Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen spielen.“
Diese Erkenntnisse erweitern frühere Beobachtungen aus Studien an Fadenwürmern und zeigen, dass Translationsstörungen ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der Proteostase in alternden Wirbeltiergehirnen sind.
Langfristig könnten die Ergebnisse neue Möglichkeiten für Therapien eröffnen, die gezielt den Verlust wichtiger Proteine verhindern – und damit neurodegenerativen Erkrankungen entgegenwirken.
Publikation
Altered translation elongation contributes to key hallmarks of aging in the killifish brain. Di Fraia D, Marino A, Lee JH, Kelmer Sacramento E, Baumgart M, Bagnoli S, Balla T, Schalk F, Kamrad S, Guan R, Caterino C, Giannuzzi C, Tomaz da Silva P, Sahu AK, Gut H, Siano G, Tiessen M, Terzibasi-Tozzini E, Fornasiero EF, Gagneur J, Englert C, Patil KR, Correia-Melo C, Nedialkova DD, Frydman J, Cellerino A, Ori A. Science. 2025, 389(6759), eadk3079. doi: 10.1126/science.adk3079. Epub 2025 Jul 31.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk3079
Datenzugang & weiterführende Informationen:
Die zugrundeliegenden Daten stehen über eine interaktive Plattform zur Verfügung:
https://genome.leibniz-fli.de/shiny/orilab/notho-brain-atlas/
Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) durch das Graduiertenkolleg ProMoAge und von der Chan Zuckerberg Initiative Neurodegeneration Challenge Network unterstützt.
Weitere Autoren dieser Forschungsarbeit stammen von der Stazione Zoologica Anton Dohrn, Neapel, Italien, dem Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried, Deutschland, der University of Cambridge, Cambridge, Großbritannien, der Technischen Universität München, Garching, Deutschland, dem Munich Center for Machine Learning, München, Deutschland, dem Universitätsklinikum Göttingen, Göttingen, Deutschland, der Universität Triest, Triest, Italien, dem Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Deutschland, und der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena, Deutschland.
Kontakt
Dr. Kerstin Wagner
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 03641-656378, E-Mail: presse@~@leibniz-fli.de