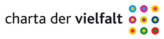Älter werden wir alle – aber können wir dabei „Forever young“ oder zumindest gesund bleiben? Wie man Alterungsprozesse möglicherweise beeinflussen kann und welche Rolle Veränderungen an Proteinen dabei spielen, hat das Graduiertenkolleg (GRK) 2155 untersucht. Der Verbund aus Halle und Jena beendet nun nach insgesamt neun Jahren intensiver Forschung seine aktive Phase und kann auf eine erfolgreiche Bilanz und einige Höhepunkte zurückblicken.
Unterschätzte Rolle von Protein-Modifikationen als Schlüsselmechanismen des Alterns
Nachdem eine Zelle ein Protein gebildet hat, erhält dieses mitunter – vereinfacht gesagt – einen „Feinschliff“. Beispiele hierfür sind die Verbindung von Zuckermolekülen oder anderen chemischen Gruppen mit den Proteinbausteinen. Solche Prozesse werden als posttranslationale Modifikationen bezeichnet. Hinter diesem sperrig anmutenden Begriff verbirgt sich eine lange Liste chemischer Veränderungen, die auf ganz unterschiedliche Weise vermittelt werden können und vielfältige Wirkungen entfalten.
„Lange Zeit galt, dass vor allem die Gene für unsere Alterung und Krankheiten hauptverantwortlich sind. Die Forschung hat jedoch gezeigt, dass posttranslationale Modifikationen dabei eine große Bedeutung haben“, erklärt , GRK-Sprecher und Alternsforscher an der Universitätsmedizin Halle.
„Sie bestimmen unter anderem darüber, wo ein Protein in der Zelle arbeitet und wie aktiv oder stabil es ist. Einige von ihnen helfen dabei, Signale in der Zelle weiterzuleiten oder Proteine chemisch zu schützen. Manchmal sind sie Teil der Standardausstattung eines Proteins, während sie in anderen Fällen erst durch Umwelteinflüsse getriggert werden und der Zelle dabei helfen, sich flexibel auf eine Situation einzustellen“, so der Biologe weiter.
Manche Protein-Modifikationen, wie beispielsweise die Verzuckerung (Glykierung), können demnach problematisch sein, wenn sie im Körper stattfinden. Werden sie jedoch über die Nahrung aufgenommen, haben sie bis zu einem gewissen Grad auch einen protektiven, also vorteilhaften Effekt.
Bilanz nach neun Jahren
Um das Altern auf molekularer Ebene besser zu verstehen, hat ProMoAge eine Vielzahl von posttranslationalen Modifikationen genauer untersucht. Und der Erkenntnisschatz kann sich sehen lassen: Es sind bereits fast 150 wissenschaftliche Publikationen und 30 abgeschlossene Dissertationen entstanden. Zahlreiche neue Veröffentlichungen sowie weitere rund 70 Abschlüsse stehen kurz vor der Fertigstellung und folgen in nächster Zeit.
Die Doktorand:innen, die entweder über explizite Projektstellen oder assoziierte Projekte mit dem GRK verbunden sind bzw. aus der Medizin kommen, stammen aus 19 Ländern. Die Alumni sind heute in der klinischen Forschung, in der Industrie und in der akademischen Forschung tätig, unter anderem in der Schweiz, Österreich, Russland, China und Deutschland. „Mit ProMoAge konnten wir einen wesentlichen Beitrag zur Alternsforschung leisten und unsere Absolvent:innen sind sehr gefragt“, sagt Prof. Simm stolz.
Wissenschaft heißt auch Gemeinschaft
Fast 100 externe Vortragende aus aller Welt, über 50 Workshops und sechs „Methodenwochen“ sorgten für reichlich Forschungstreibstoff. Neben harten Daten setzte ProMoAge auf ein lebendiges Miteinander: Es gab Escape Rooms, Trommelkurse und Schnitzeljagden. „Meine persönlichen Höhepunkte waren die gemeinsamen Treffen bei ProMoAge. Wir hatten von Anfang an ein tolles Verhältnis zwischen den Gruppen aus Jena und Halle. Bei unseren mehrtägigen Retreats und eintägigen Workshops galt immer die Devise ‚Science and Fun‘, also Spaß an der Wissenschaft zu haben.“
Ein musikalisches Highlight war der Gastvortrag „Resilienz bis ins höchste Alter – was wir von Johann Sebastian Bach lernen können“ des Heidelberger Psychologen Prof. Andreas Kruse. Mit einer Kombination aus Vortrag und eigenem virtuosem Klavierspiel zeigte er auf einprägsame Weise die Auswirkungen des Alterns anhand der Veränderungen in Bachs Werken.
Ein Ohrwurm als liebevoller Abschiedsgruß
Und schließlich ging es auch musikalisch zu Ende: Zur Abschlussveranstaltung in der Leucorea in Wittenberg hatten die aktiven Doktorand:innen den Hit „Forever Young“ von Alphaville aus den 1980er-Jahren umgedichtet und damit eine humorvolle und zugleich poetische Hommage an das Leben junger Wissenschaftler:innen in der biomedizinischen Forschung geschaffen. Im Lied ging es um die Hoffnung, dass die Experimente gelingen und die Gutachter:innen den wissenschaftlichen Veröffentlichungen wohlgesonnen sind, um Forschungsmethoden, den Wunsch nach qualitativ hochwertigen Daten und die gewonnenen Erkenntnisse.
Der Verbund vereinte Forschungsgruppen der Universitätsmedizin Halle, der Friedrich-Schiller-Universität Jena, des Universitätsklinikums Jena und des Leibniz-Instituts für Altersforschung - Fritz-Lipmann-Institut (FLI) Jena. Er startete im Jahr 2016 und wurde nach einer positiven Evaluation im Jahr 2020 um weitere vier Jahre verlängert: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) förderte das Vorhaben insgesamt mit knapp elf Millionen Euro. Nun wird die Suche nach den Geheimnissen des Alterns fortgesetzt. Neue wissenschaftliche Verbünde der Universitätsmedizin Halle zum Thema Alternsmedizin, wie zwei jüngst gestartete Vorhaben im Rahmen des Wilhelm-Roux-Programms der Medizinischen Fakultät, knüpfen an.